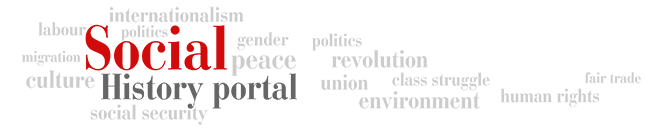Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion um 1989/90 und der anschließenden Transformation der meisten staatssozialistischen Gesellschaften schien der Kapitalismus seinen globalen Siegeszug angetreten zu haben. Mehr als 35 Jahre später zeichnet sich jedoch ab, dass dieser keineswegs in dem von Francis Fukuyama postulierten „Ende der Geschichte“ gipfelte, also der endgültigen Durchsetzung einer liberalen Weltordnung. Stattdessen lässt sich in vielen der ehemals staatssozialistischen Gesellschaften, nach einer Phase ungezügelter Deregulierung und Privatisierung, oft begleitet von einer verheerenden Deindustrialisierung, die Etablierung nationalistisch-autoritärer Regimes beobachten, teilweise mit revanchistischen Zügen, etwa im Falle Russlands. Einige Beobachter sprechen von einem neuen Modell des Staatskapitalismus oder eines „politischen Kapitalismus“ (Branko Milanović), der neoliberale Umverteilung mit Formen der Kommandowirtschaft kombiniert. Zugleich bestand die postsozialistische Transformation nicht nur im Abbau alter Staatsindustrien, sondern auch in der Etablierung neuer Produktionsstätten, die in transnationale Lieferketten eingebettet wurden und auf gut ausgebildete und billige Arbeitskräfte zurückgreifen konnten. Am prominentesten ist hier sicherlich das Beispiel der chinesischen Sonderwirtschaftszonen. Aber auch so unterschiedliche Länder wie Vietnam, Kasachstan oder die Slowakei sind heute hochindustrialisierte Produktionsstandorte des globalen Kapitalismus.
Die Arbeiterklasse in postsozialistischen Gesellschaften ist daher keinesfalls verschwunden, sie gilt aber meist als unorganisiert, atomisiert und passiv – vor allem im Vergleich mit den „westlichen“ Wohlfahrtsstaaten, in denen Gewerkschaften eine größere Rolle spielen. Dagegen stellen Wissenschaftler:innen immer wieder Formen des „Eigensinns“ und oft verdeckte Praktiken des Alltagswiderstands in den postsozialistischen Gesellschaften fest. Ein wichtiges Element bildet dabei eine Form der „moralischen Ökonomie“, die sich aus der Erinnerung und nostalgischen Verklärung der sozialistischen Vergangenheit speist. Diese stellt daher ein umkämpftes Erbe dar, dass nicht nur von herrschenden Eliten zur eigenen Legitimation in Abgrenzung zum „Westen“ im Rahmen geopolitischer Konkurrenz genutzt wird, sondern auch widerständiges Verhalten nähren kann.
Ziel des Schwerpunktheftes ist es daher, die Erfahrungen von Arbeiterinnen und Arbeitern während der Transformation postsozialistischer Gesellschaften in den Blick zu nehmen. Wir streben dabei einen möglichst globalen Überblick an. Der behandelte Zeitraum kann bereits vor 1989 ansetzen, wenn er den Wandel in der Transformationsperiode danach in den Blick nimmt. Mögliche Themen können sein:
- Der Wandel der Arbeitswelt, insbesondere im Betrieb als einst zentralem Ort des sozialistischen „Gesellschaftsvertrags“
- Die Veränderung der Reproduktion im Haushalt unter den Bedingungen niedriger Löhne und des Wegbrechens sozialstaatlicher Absicherung
- Die Artikulation von Klassenkonflikten und die Rolle von Gewerkschaften
- Die Rolle der Erinnerung und des sozialistischen Erbes, insbesondere mit Blick auf Selbstbilder, Motivationen und Handlungen
- Die Erfahrung und Konstituierung von Arbeiter:innen als Klasse, sowohl in klassischen Industriebranchen, als auch im Dienstleistungssektor und der Landwirtschaft, insbesondere mit Blick auf Geschlechterverhältnisse, die Rolle der Jugend und von Migrant:innen
- Der Wandel der sozialen Mobilität, etwa im Vergleich zur Zeit des Staatssozialismus, und der Aufstieg neuer sozialer Schichten Formen und Fristen
Wir bitten um die Einreichung aussagekräftiger Exposés bis zum 15. Januar 2026, auf Deutsch oder Englisch (andere Sprachen sind auf Anfrage möglich), im Umfang von 2500 Zeichen, aus denen Thema, Methode und Quellenbasis des geplanten Artikels hervorgehen. Auf Grundlage der Exposés werden wir gezielt Beiträge anfordern. Die Abgabefrist für die ausgearbeiteten Artikel ist der 30. Juni 2026. Alle Beiträge durchlaufen vor der Veröffentlichung ein mehrstufiges internes Begutachtungsverfahren (review). Erst nach Einreichung und Begutachtung der Endfassung erfolgt die Publikationszusage. Wir veröffentlichen nur Originalbeiträge, mit Ausnahme von zuerst nicht auf Deutsch erschienenen Artikeln. Beiträge für „Arbeit – Bewegung – Geschichte“ werden nicht honoriert. Manuskripte bitte per E-Mail als docx-Datei einsenden. Die ausgearbeiteten Beiträge sollen 50 000 Zeichen inkl. Leerzeichen nicht überschreiten. Bitte beachten unsere Hinweise für Autor:innen beachten.
Kontakt und Abgabe: cfp@arbeit-bewegung-geschichte.de
Der Zeitplan in Kürze:
• Einreichung der Exposés: 15. Januar 2026
• Einreichung der fertigen Beiträge: 30. Juni 2026
• Veröffentlichung des Schwerpunktheftes: Voraussichtlich Januar 2027
H/Soz/Kult-Link: https://www.hsozkult.de/event/id/event-158563