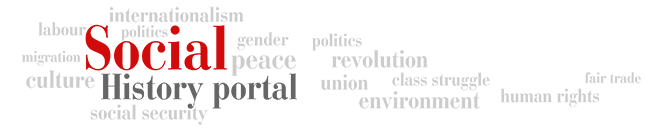Stuttgart/Germany
Organiser: Universität Stuttgart (Bundeshöchstleistungsrechenzentrum (HLRS))
Postcode: 70569
City: Stuttgart
Country: Germany
Takes place: In person
Dates: 16.09.2026 - 18.09.2026
Deadline: 15.02.2026
Technologische Entwicklungen durchdringen alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Immer wieder führen sie demokratische Strukturen, Werte und Prozesse an ihre Grenzen – zugleich eröffnen sie neue Möglichkeiten zur Beteiligung, Transparenz und Gestaltung. Die Beziehung zwischen Demokratie und Technik ist wechselseitig: Technologien beeinflussen politische Entscheidungsprozesse, Partizipationsformen und Öffentlichkeiten, während demokratische Normen und Institutionen die Entwicklung, Regulierung und Anwendung technologischer Systeme prägen.
CfP: Demokratische Technik? Technische Demokratie?
Tagung Stuttgart, 16.-18. September 2026
Geplante Publikation als Themenheft 2027 der Zeitschrift Technikgeschichte
Deadline für Einreichungen (Themenskizze): 15. Februar 2026
Technologische Entwicklungen durchdringen alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Immer wieder führen sie demokratische Strukturen, Werte und Prozesse an ihre Grenzen – zugleich eröffnen sie neue Möglichkeiten zur Beteiligung, Transparenz und Gestaltung. Die Beziehung zwischen Demokratie und Technik ist wechselseitig: Technologien beeinflussen politische Entscheidungsprozesse, Partizipationsformen und Öffentlichkeiten, während demokratische Normen und Institutionen die Entwicklung, Regulierung und Anwendung technologischer Systeme prägen.
Aktuell werden diese Fragen vor allem im Hinblick auf die Folgen des zunehmenden Gebrauchs digitaler Technologien diskutiert, etwa im Hinblick auf soziale Medien und algorithmische Entscheidungsprozesse: Wie verändern sich demokratische Debatten und Entscheidungen, wenn sie etwa durch ‚likes‘, ‚memes‘ und ‚deep fakes‘ befeuert werden – und wie könnte eine ‚liquid democracy‘ aussehen? Die Konferenz möchte diese drängenden aktuellen Fragen aufnehmen und den Blick weiten: Sie fragt grundsätzlicher nach dem Verhältnis von technologischen Bedingungen und demokratischen Prozessen.
Historisch und systematisch rückt damit die Beziehung von poiesis und praxis in den Blick: Inwiefern müssen demokratische Praktiken technisch und medial hergestellt werden? Und inwiefern verdankt sich die spezifische Gestalt einer demokratischen Lebensform immer auch ihrer technischen Formung?
Schon die attische Demokratie war durch bestimmte architektonische Strukturen und einen kodifizierten Schriftgebrauch geprägt. Mitglieder des höchsten Gerichts wurden mit einer Losmaschine bestimmt, Redezeit mit Wasseruhren kontrolliert. Moderne Demokratien beruhen auf Berechnungen der Sitzverteilung, Mechanismen der Abgabe und Auszählung von Stimmen, somit auch auf entsprechenden Regularien und Autoritäten, auf statistischen Erhebungen und amtlichen Feststellungen. Parlamentarische Architektur spielt immer noch eine Rolle, aber auch Fraktionszwänge, die sich ihrerseits technischen Sachzwängen unterwerfen. Partizipationsverfahren einerseits, Expertenkultur andererseits stellen das Idealbild einer repräsentativen Demokratie infrage. Verschärft wird dies aktuell durch die Verlagerung von Entscheidungen in Modelle (Modeling for Policy).
Derzeit wird die Demokratisierung von Technikentwicklung programmatisch im Rahmen von „open science and innovation“ verfolgt und vor einer künstlich intelligenten Entmachtung demokratischer Selbstverständigungsprozesse gewarnt. Hinter dieser Kulisse sucht das Jahrbuch Technikphilosophie zusammen mit der Zeitschrift Technikgeschichte auch die unterbelichteten Problematiken im Wechselspiel von Technik und Demokratie auf. Angesichts der 1961 von Eisenhower formulierten Warnung vor der Demokratiefeindlichkeit des „military-industrial complex“ wird immer wieder gehofft und gefragt, ob manche Technologien vielleicht inhärent demokratieoffener sein können als andere. Wir laden Beiträge ein, die sich mit der Technizität demokratischer Prozesse befassen.
Die Beiträge sollen vom 16.-18. September 2026 zunächst auf einer internationalen Konferenz am Bundeshöchstleistungsrechenzentrum (HLRS) der Universität Stuttgart vorgestellt und diskutiert werden. Als Keynote-Speaker der Veranstaltung konnten bereits Stefan Böschen (RWTH Aachen), Sheila Jasanoff (Harvard University), Nadja Mazouz (ETH Zürich) und Ortwin Renn (RIFS Potsdam) gewonnen werden.
Für die einzureichenden Beiträge sind beispielhaft folgende Themen und Fragestellungen denkbar:
1) Authoritarian and Democratic Technics (Mumford): Worin besteht der Zusammenhang zwischen demokratischen und technologischen Werten oder Wertbegriffen (z.B. Transparenzforderungen, Transparenzgebote)? Konzentriert sich politische und ökonomische Macht in technischen Systemen und kann dem eine dezentralisierte Technik effektiv entgegenwirken? Was wären demokratische Affordanzen?
2) Technology as Ideology (Habermas): Während sich die Demokratie von der Technokratie abgrenzt, sieht sie sich technischen Sachzwängen konfrontiert. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf Verwaltungsprozesse in Behörden. Gibt es einen technologischen Strukturwandel der Öffentlichkeit? Verlangen Modernisierung und Aufklärung einen inhärenten Zusammenhang zwischen technischem und gesellschaftlichem Fortschritt?
3) Autonomous Technology (Winner): Die Beharrlichkeit und Eigenlogik einer einmal etablierten Technik schränkt die Autonomie des Menschen ein. Kann es als Gegenentwurf ein Design demokratischer Räume geben, die wie am Beispiel Otto Neuraths von der Siedlungsplanung bis hin zur Bildstatistik reichen? Was macht die Atmosphäre eines demokratischen Erfahrungsraums aus: Norman Fosters Reichstagskuppel? Oscar Niemeyers Brasilia?
4) The Technological Society (Ellul): Der Formwandel demokratischer Prozesse ist mit einem Wandel der zugrundeliegenden Technologien verbunden – und umgekehrt? Gibt es Technikutopien, neoliberale und marxistische technologies for human enhancement, eine spezifisch demokratische Technikpolitik (responsible research and innovation)? Ist schon die Unumkehrbarkeit technischer Entwicklungen antidemokratisch?
5) Politics of Nature (Latour): Produziert Technikentwicklung einen erweiterten Politik- und vielleicht auch Demokratiebegriff? Über die Vernetzung mit nicht-menschlichen Akteuren treten die Ansprüche künftiger Generationen, die Rechte von Tieren oder Landschaften in den politischen Diskurs, bilden ein Parlament der Dinge (Rohstoffe, Endlager, Lieferketten).
6) Political Automation (Albrecht): Die basalen Techniken der Stimmabgabe (voting systems und voting machines) setzen sich fort in der „gamification“ der politischen Kommunikation durch technische Metriken (likes und re-tweets) und führen weiter zur politischen Orientierung oder Stimmungsbildung durch KI- oder Simulationstechniken (nudging) bis hin zu den gegenwärtig diskutierten Entscheidungsalgorithmen, aber auch zu Formen der Bürger·innenbeteiligung (liquid democracy). Einerseits gilt Technik als ursächlich für demokratische Erosion, andererseits wird sie als ihre Retterin ins Spiel gebracht.
Interessierte Autorinnen und Autoren werden gebeten, ihre Vorschläge bis zum 15. Februar 2026 in Form einer Themenskizze von mindestens 300 Wörtern einzureichen. Im Anschluss an die Tagung plant die Zeitschrift Technikgeschichte eine Publikation als Themenheft 2027. Alle Beiträge durchlaufen das übliche Reviewverfahren. Die Einreichungsfrist für die Zeitschrift ist der 15. Dezember 2026.
Bitte senden Sie Ihre Einreichungen und eventuelle Rückfragen an:
Redaktion Technikgeschichte
Dr. Katharina Zeitz
Katharina.zeitz@nomos.de
Kontakt
Redaktion Technikgeschichte
Dr. Katharina Zeitz
Katharina.zeitz@nomos.de