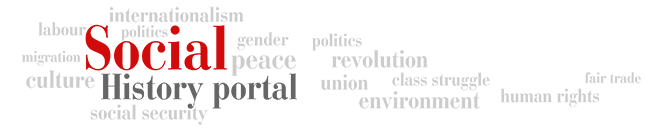Halle (Saale)/Germany
Am 26. und 27. März 2026 ist das Institut für Geschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Gastgeber des Netzwerktreffens Oral History 2026. Wie jedes Jahr freuen wir uns über Einreichungen und Vorschläge für Vorträge, Projektpräsentationen oder Kurzvorstellungen, die die ganze Bandbreite der Oral History abdecken.
Netzwerktreffen Oral History 2026 in Halle (Saale)
Besonders willkommen sind Beiträge zu folgenden vier Themenschwerpunkten:
Politisierung der eigenen Lebenserfahrung
Übergeordnete gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Verhältnisse spiegeln sich in den individuellen Erfahrungen, Erzählungen und Lebensläufen – und zugleich prägen subjektive Perspektiven den gesellschaftlichen Blick auf historische Prozesse. Im Rückblick auf das eigene Leben werden Erfahrungen auch vor dem Hintergrund gegenwärtiger Debatten, Diskurse und Tendenzen gedeutet. Wir möchten darüber diskutieren, wie sich Fremd- und Selbstdeutungen von Biografien im Laufe der Zeit verändern und welche Rolle verschiedene politisierte Erfahrungen einnehmen können.
Arbeit und Identität
Erwerbs- wie auch Care-Arbeit prägen einen Großteil unserer Lebenszeit und Biografien. Insbesondere eine berufliche Tätigkeit, das Arbeitsumfeld und die zugehörige soziale Gruppe tragen wesentlich zur Identitätsstiftung bei.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie Berufsgruppen in unterschiedlichen historischen Kontexten ihr Selbstbild konstruier(t)en. Wie erlebten Menschen beispielsweise Selbstständigkeit, Leiharbeit, Frühverrentung oder Arbeitslosigkeit und welche Auswirkungen hatte das auf ihre lebensgeschichtliche Erzählung? Gingen berufliche Brüche mit Identitätsverlust einher? Und welches Bild entwarfen andere gesellschaftliche Akteur:innen wie beispielsweise Staat und Parteien demgegenüber?
Forschungsethische Fragen
Dieser sehr offen angelegte Schwerpunkt rückt die Verantwortung von Forschenden in den Fokus. Neben vielen anderen Themen könnte beispielsweise der Umgang mit traumatischen Erinnerungen oder unterschiedlichen politischen Einstellungen in der Interviewsituation selbst diskutiert werden. Ein Schlaglicht soll auch auf die Herausforderungen der Digitalisierung geworfen werden. Wie beeinflusst der Einsatz von KI im Forschungsprozess die Nähe zur Quelle? Inwieweit sind die FAIR-Prinzipien und Privatsphäre/Datenschutz vereinbar?
“Hinhör-Gruppen”
Auch in diesem Jahr möchten wir Raum für kollegiale Beratung geben. In moderierten Kleingruppen, den sogenannten „Hinhör-Gruppen“, können Fragen der Interview- und Forschungstätigkeit am Praxisbeispiel diskutiert werden. Wir laden dazu ein, gemeinsam die von Ihnen eingereichten Audio- und Videomitschnitte anzuhören/anzusehen und zu interpretieren. Hilfreich wäre hierbei ein kurzes Abstract, welches das jeweilige Fallbeispiel sowie die zentrale Frage- oder Problemstellung skizziert.
Diese Schwerpunkte sind wie immer als Vorschläge zu verstehen und können durch andere Themen ergänzt werden. Zusätzlich zur Einreichung thematischer Beiträge oder Abstracts für die kollegiale Beratung bzw. „Hinhör-Gruppen“ besteht – wie bereits in den vergangenen Jahren – für Netzwerke, Institute, Projektverbünde und vergleichbare Einrichtungen die Möglichkeit, sich im Rahmen eines kurzen Zeitslots von zehn Minuten vorzustellen und darüber hinaus mit einem Informationsstand vor Ort präsent zu sein.
Bitte melden Sie sich bis zum 19.10.2025 bei Stefan Müller (stefan.mueller@fes.de) oder Johanna Hohaus (johanna.hohaus@geschichte.uni-halle.de) und geben Sie an, ob Sie sich für einen Vortrag, eine Hinhör-Session, eine Kurzpräsentation oder einen Infostand bewerben.