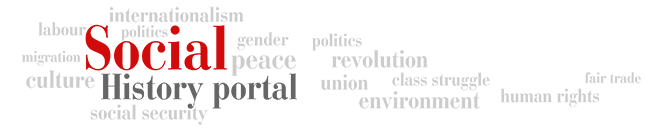Gießen/Germany
Am 29. März 1826 wurde Wilhelm Liebknecht in Gießen geboren. Die Stadt Gießen nutzt diesen 200. Geburtstag für ein Wilhelm-Liebknecht-Jahr, in dem mittels verschiedener Events einem „Gründervater“ der Sozialdemokratie erinnert und zentrale Anliegen Liebknechts unter Gegenwartsperspektiven beleuchtet werden.
Als Teil dieses Wilhelm-Liebknecht-Jahrs richten die Justus-Liebig-Universität Gießen, das Archiv der sozialen Demokratie und die Universitätsstadt Gießen eine interdisziplinäre wissenschaftliche Konferenz aus, auf der über Wilhelm Liebknecht und vier für Liebknecht zentrale politische Felder diskutiert werden soll: Demokratie, Krieg/Frieden, Bildung und Publizistik. Als Teil des Wilhelm- Liebknecht-Jahrs möchten wir mit der Konferenz Forschungen anregen und Wissenschaftler:innen einladen, ihre Themen vor dem Hintergrund der Geschichte der Arbeiter:innenbewegung zu präsentieren. Neben Historiker:innen sind Wissenschaftler:innen aller sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen eingeladen.
Die vier inhaltlichen Perspektiven auf Wilhelm Liebknecht (Demokratie, Krieg/Frieden, Bildung, Publizistik) sind anschlussfähig an die Gegenwart – nicht in dem Sinne, dass Positionen und Analysen Wilhelm Liebknechts schlicht fortgeschrieben werden könnten, sondern insoweit, als es sich um anhaltende gesellschaftliche Herausforderungen und Konflikte handelt.
Themen
Demokratie
Wilhelm Liebknecht beschäftigte sich in seinen Schriften und seinem politischen Kampf mit dem demokratischen Staat und der sozialistischen Gesellschaft. Sein Demokratieverständnis ging über die Forderung nach dem freien Wahlrecht hinaus und verblieb nicht auf der formalen Ebene. Vielmehr ging es um die umfassende Emanzipation der Gesellschaft vom monarchischen Staat und von polizeistaatlicher Unterdrückung. Den Sozialismus und den Zukunftsstaat konnte Liebknecht nur demokratisch denken. Obwohl Liebknecht für die Verbreitung der Marx‘schen Ideen in der Sozialdemokratie eintrat und später die revisionistischen Vorstellungen Eduard Bernsteins ablehnte, wandte er sich auch gegen in London formulierte „kindische Revolutionsphrasen“ (Brief an Schwarzenberg, 3.10.1878). Somit lassen sich die folgenden Aus-einandersetzungen in der Arbeiter:innenbewegung um Reform oder Revolution bis zu Wilhelm Liebknecht und in die Gründungsphase der Sozialdemokratie zurückverfolgen.
Krieg und Frieden
„Wozu denn diese gewaltigen Rüstungen? Welche Nation bedroht uns?“ rief Wilhelm Liebknecht im Jahr 1900 im Reichstag aus (Verhandlungen, Bd. 171, 1898/1900, S. 6025). Er reagierte damit auf eine Vorlage zur Vergrößerung der Flotte und auf Argumente seiner Vorredner, die weltpolitische Lage und das na-tionale Prestige würden diese Vergrößerung fordern. Anstelle des stehenden Heeres und der Wehrpflicht trat Liebknecht vehement für ein Milizsystem nach Schweizer Vorbild ein. Der Kampf gegen „die Stärkung des Militarismus und des Kapitalismus“ (ebd., S. 6026) durchzog sein politisches Leben, und bereits 1870 hatte sein Mitstreiter August Bebel große Mühe zu verhindern, dass Liebknecht die Kriegskredite für das von Frankreich angegriffene Deutschland ab-lehnte, sondern sich im Norddeutschen Reichstag lediglich der Stimme enthielt. Der Konflikt von 1870 kann mithin als Vorbote von 1914 und alle folgenden Debatten in der Arbeiter:innenbewegung um Krieg, Frieden und „Vaterlandsver-teidigung“ gedeutet werden – ein mit Blick auf die militärische Unterstützung der Ukraine oder die Reaktivierung der Wehrpflicht hochaktuelles Thema.
Bildung
Die Geschichte der Sozialdemokratie ist auf das Engste mit dem Kampf um Bildung und den gesellschaftlichen Aufstieg durch Bildung verknüpft. Paradigmatisch steht hier der Titel eines Vortrags von Wilhelm Liebknecht aus dem Jahr 1872, „Wissen ist Macht – Macht ist Wissen“. Er kritisierte die Machtpolitik der herrschenden Klasse und argumentierte, dass im Industriekapitalismus dem Proletariat allumfassende Bildung bewusst vorenthalten werde. Der Aufstieg aus der Unbildung könne somit nicht aus der Verbesserung des Schulwesens herrühren, so Liebknechts zeitgenössische Kritik des linken Liberalismus, son-dern erst im freien Volkstaat gelingen. Nicht durch Bildung gelange man zur Freiheit, sondern durch Freiheit zur Bildung. Dieses Konzept des sozialen Aufstiegs der Arbeiter:innenschaft durch Bildung verlor in der Geschichte der Sozialdemokratie jedoch seinen kollektiven Charakter. Bereits während der Hoch-phase sozialdemokratischer Bildungspolitik in der Nachkriegszeit fokussierte das sozialdemokratische Aufstiegsversprechen das Individuum, auch wenn da-bei das Schul- und Hochschulwesen beträchtlich ausgebaut wurden.
Publizistik
Wilhelm Liebknecht war im Laufe seines beruflichen Lebens Journalist, Zei-tungsherausgeber (des 1876 gegründeten Vorwärts) und Reichstagsabgeordneter. Briefe an den Verleger Cotta aus dem Londoner Exil (1850-62) belegen seine prekäre Existenz als Journalist, zeigen aber auch die Kraft, die Liebknecht dem geschriebenen Wort im Kampf gegen Monarchie, Zensur und Restauration beimaß. Zahlreiche Gefängnisaufenthalte bis an sein Lebensende waren die Konsequenz seines mündlichen wie schriftlichen Einsatzes für eine sozialdemokratische politische Erneuerung. Der Briefwechsel mit Marx und Engels gibt dabei Aufschluss über die internen Richtungskämpfe und die umstrittene Stellung, die Liebknecht einnahm. Er selbst verstand sich gegenüber den beiden in-tellektuellen Köpfen als Praktiker, dem biografisch der ausführliche Bildungs-weg versagt geblieben war. Der Briefwechsel mit Marx und Engels zeigt zugleich die Gemeinschaftsarbeit, die hinter medialen Auftritten stand, und er liefert ein höchst aktuelles Zeugnis über die Frage nach der Gewichtung von radikalen Positionen gegenüber einer kompromisssignalisierenden Mäßigung von politischen Äußerungen.
Fragen
Auf der Konferenz interessieren wir uns für zwei Ebenen: Wir möchten erstens den historischen Wilhelm Liebknecht und die Entwicklung der Arbeiter:innenbewegung und der Sozialdemokratie beleuchten. Zweitens möchten wir vor dem historischen Hintergrund über die Gegenwart diskutieren. Ob Medienwissenschaften, politikwissenschaftliche Demokratieforschung, Friedens- und Konfliktforschung, Bildungswissenschaften und noch ganz andere Disziplinen: Die von uns skizzierten Themen, Konflikte und Fragen sind seit dem 19. Jahrhundert regelmäßig reformuliert worden und bieten auch heute Anlass zur Diskussion.
• Das Schaffen Liebknechts steht in einer Tradition und Geschichte oppositioneller Publizistik. Davon ausgehend ließe sich fragen, wie heute politische publizistische Arbeit funktioniert und über welche Medien; welche Verschiebungen es gab, welche Rolle Zensur spielt(e), wie wir heute demokratische Meinungsbildung verstehen oder wieviel Aktivismus dafür möglich und notwendig wäre.
• Liebknechts Handeln und Schriften laden dazu ein, über die großen Fragen von Krieg und Frieden, von Auf- und Abrüstung und der Rolle des Militärs nachzudenken. Erleben wir beispielsweise eine Rückkehr zur Großmächtepolitik des 19. Jahrhunderts, wie es manche heutige Zeitdiagnose behauptet, und auf welches 19. Jahrhundert wird hier Bezug genommen? Ist es in der Gegenwart überhaupt sinnvoll oder weiterführend, mit (sozialdemokratischen) Perspektiven auf Krieg und Frieden aus dem Kaiserreich zu arbeiten?
• Mit Blick auf die Bildungspolitik ließe sich beispielsweise fragen, welche Verschiebungen stattfanden, sodass Bildung nicht mehr als Mittel kollektiven, sondern nur noch individuellen gesellschaftlichen Aufstiegs verstanden wird. Vice versa könnte gefragt werden, ob angesichts der in Deutschland nach wie vor bestehenden Abhängigkeit der Bildungskarrieren vom sozialen Status die Vorstellungen Liebknechts sinnvoll revitalisiert werden können.
• Anknüpfend an Liebknechts Reflexionen über Demokratie und Sozialismus könnte gefragt werden, welche politischen Strategien progressive demokratische Akteure und Bewegungen heute nutzen, welche Konflikte innerhalb des progressiven politischen Lagers bestehen oder wie Bürger:innen ihre partizipative demokratische Gestaltungsmacht (besser) entfalten können. Auch wenn die Sozialismusvorstellungen des 19. Jahrhunderts heute kaum mehr attraktiv erscheinen, so stellt sich dennoch die Frage nach möglichen Transitionspfaden in eine gerechte Gesellschaft und Demokratie der Zukunft.
Format
Ausgehend von den skizzierten Themen und Fragen – aber auch gerne darüber hinaus! – bitten wir um Vorschläge und Einreichungen für die Konferenz. Wir werden die Konferenz mit unterschiedlichen Formaten gestalten, zum Beispiel klassische Panels, Round Tables, Open Spaces und Poster. Wir bitten um Abstracts im Umfang von 300 bis 500 Wörtern, die das Thema und eine Fragestellung skizzieren und die auch gerne einen Formatvorschlag für die Präsenta-tion beinhalten.
Deadline für die Einreichung der Abstracts ist der 31. Januar 2026:
SekrBrockmeyerNG@geschichte.uni-giessen.de
H/Soz/Kult-Link: https://www.hsozkult.de/event/id/event-158770
Reisekosten für Vortragende werden durch die Veranstalter:innen übernommen.
Bettina Brockmeyer, Justus-Liebig-Universität Gießen
Dorothée de Nève, Justus-Liebig-Universität Gießen
Stefan Müller, Archiv der sozialen Demokratie
Christian Pöpken, Stadtarchiv Gießen
Jan Labitzke, Stadt Gießen